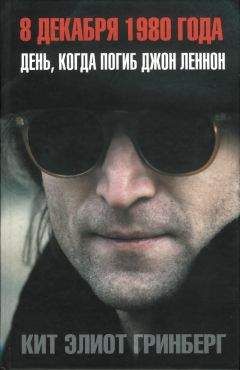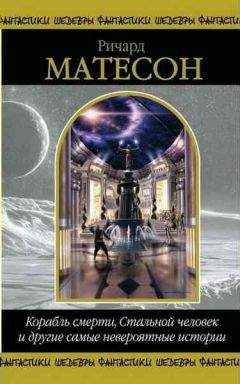Sibylle Lewitscharoff - Blumenberg
Die kindliche Entflammtheit, die für den erwachsenen Richard nicht so ohne weiteres, höchstens mit einem karikierenden Grinsen, wiederzugewinnen war, konnte ihm bei seiner Dissertation nicht viel nutzen. Es nützte auch nichts, daß der kleine Richard unter den zungenfertigen Parthern immer einen oder mehrere Panther sich vorgestellt hatte, was die Sache allerdings sehr aufregend machte, denn Richard hätte sich für sein Leben gern mit einem ausgewachsenen Panther unterhalten. Nein, Richard war gescheitert, weil es ihm nicht gelungen war, hintersinnige Blumenbergfragen an die biblischen Texte heranzutragen und für diese Fragen wie in einem hochklassigen Billardspiel über die Bande treffsichere Antworten aufs Papier zu hacken.
Einzig das Kapitel über das pfingstliche Wasservogelsingen der Ortschaft Ringelai im Bayerischen Wald war nach Richards Dafürhalten passabel, wenn nicht sogar gewitzt ausgefallen, vielleicht auch noch die Fußnote über einige mittelalterliche jüdische Gemeinden, in denen es Brauch gewesen war, die Kleinen zu Shavuot im Alter von etwa fünf Jahren auf das Lesepult der Synagoge zu stellen und sie dann in die Shul zu tragen, wo sie die ersten hebräischen Buchstaben lernten und mit Süßigkeiten gefüttert wurden, weil die Tora ja süß in sie hineingehen sollte — alles schön und gut, aber er hatte diese einzelnen Teilchen Blumenberg ja nicht getrennt von den anderen, zähen Teilen, die sich gedanklich nie vom Boden lösten, zur Durchsicht geben können. Zäh, ja, zäh war er zwischen dem Alten und dem Neuen Testament hin- und hergekreuzt, hatte brav bei Moses begonnen, war über das Buch Ruth zu Joel, zur Apostelgeschichte, zu Johannes gelangt, hatte brav von den Reparaturleistungen gehandelt, die das Pfingstwunder an der Geschichte vom Turmbau zu Babel vornahm, aber so geistesöde wie ein Bibelingenieur, und nicht einmal ein guter, bis auf der vermaledeiten Seite sechsundachtzig die Quälerei zum Erliegen gekommen war.
Was hatte er sich abgerackert, um alles über die Meder, die Parther, die Elamiter, die Kyrener in Erfahrung zu bringen, die nach der wundersamen Fleischerleuchtung so munter mit den Ägyptern und Römern geplaudert hatten, in ihrer jeweils eigenen Sprache, doch von jedem anderen verstanden wie im Flug. Was aber Blumenberg seinen Studenten von Vorlesung zu Vorlesung lässig vorgeführt hatte, genau das war Richard versagt geblieben: auf etwas anderes hinzublicken, um zur Erkenntnis des einen anstelle von einem vagen Einerlei zu gelangen.
Dann hatte er von seiner Großmutter Geld geerbt und den Entschluß gefaßt, ein Jahr in Südamerika zu verbringen. Er hatte sich vorgenommen, den ganzen langen Amazonas per Schiff zu befahren, das heißt, zunächst nicht den Amazonas, sondern den Rio Ucayali, einen seiner Hauptzuflüsse. Und nun befand er sich endlich auf dem Amazonas.
Großmutters Geld war in Travellerschecks und Dollars verwandelt worden, die er in einer Spezialtasche aus Baumwollstoff mit Reißverschluß am Leib trug. Seine eigentliche Reisetasche hatte schon bessere Tage gekannt. Ihre rötlichen Gobelinstickereien waren inzwischen abgeschabt und grau, etliche Nähte geplatzt, die Henkel brüchig. Trotzdem war er stolz auf das Ding. Eine neugierige Schäferin beugte sich über einen schlafenden Hirten — auf der Vorderseite. Auf der Rückseite war die Schäferin selbst entschlafen. Die Tasche machte ihn glauben, er sei ein reisender Held aus einer glorreichen früheren Zeit und habe mit den Touristen, die sonst unterwegs waren, nicht das geringste zu tun.
Ein echtes Abenteuer war sie gewesen, seine Ankunft in der tropischen Welt. Spätabends war er auf dem kleinen Flughafen von Pucallpa gelandet, der den Namen eines peruanischen Capitán trug. Kaum betrat er das Treppchen, um die Propellermaschine zu verlassen, legte sich die feuchtschwüle Tropennacht wie ein erstickendes Tuch um seinen Körper. Die ersten Atemzüge waren ungewohnt dick und warm. Millionen von Insekten umschwirrten die Scheinwerfer, die an Gerüsten auf dem Dach der Empfangshalle montiert waren und die Landebahn von hoch oben bestrahlten. Ein Gesirr und Gezisch lag in der Luft, Gezisch mit winzigen Rauchschwaden, von den Insekten erzeugt, die an den heißen Strahlern verbrannten. Richard wußte, daß in den Tropen unvorstellbare Massen von Insekten lebten, jetzt sah er zum ersten Mal solche Massen im gleißenden Kunstlicht einer Tropennacht, war davon fasziniert und erschreckt.
Das Hotel hatte ihm sofort gefallen. Man betrat es durch Schwingtüren wie einen amerikanischen Saloon. Er hatte sich als Cowboy gefühlt, als er seine Schritte auf dem Holzboden knarren hörte und die kostbare Tasche neben der Rezeption, die zugleich eine Bar war, auf einen Hocker stellte. Müde Typen hingen herum und spielten Domino, hoben die Köpfe kaum, um ihn zu beobachten. Kakerlaken gab es bestimmt, aber offenbar waren sie zu schüchtern, um sich zu zeigen, als er das Licht im Zimmer anknipste. Ein hohes, dunkles Bett aus Kolonialtagen erwartete ihn, von der Decke hing das obligate Moskitonetz.
Zum Frühstück wurde ein buttriger Maniokbrei mit gebratenen Bananen serviert, dazu ein ebenholzschwarzer Kaffee aus einer grauweiß gesprenkelten Blechtasse, die er sogleich ins Herz schloß und am liebsten mit einer Schnur an seine Tasche gehängt hätte. Als die Türen vom Saloon aufschwangen, sah er niedere Häuserzeilen, darüber einen bleigrauen, tief herabhängenden Himmel, durchsetzt von rötlichen Staubwolken, sah kreiselnde Windböen, die Staub von den gestampften Lehmwegen aufrührten. Das Hotel lag an der geteerten Hauptstraße, die hinab zum Fluß führte.
Am Flußufer hatten Frachtboote festgemacht. Am Ladeplatz trugen halbnackte Träger Körbe und prall gefüllte Säcke auf den Schultern, in zwei geordneten Marschkolonnen entluden und beluden sie die Schiffe, dazwischen wimmelten Passagiere, die in die Boote drängten oder ihnen soeben entstiegen waren. Richard konnte gar nicht anders, als diesen Anblick mit Szenen aus Hollywoodfilmen zu vergleichen, in denen römische oder ägyptische Sklaven das Geschäft der Mühseligen und Beladenen verrichteten, allerdings waren in diesen Filmen die Gewänder meistens weiß, während bei den Männern hier das wenige, das sie am Leib trugen, in allen Farben leuchtete. Auch waren die Männer stämmiger und kleiner. Indios aus dem peruanischen Dschungel arbeiteten hart am Ufer des Rio Ucayali.
Bevor er sich dem großen Fluß überließ, wollte Richard die Nebenarme des Ucayali erkunden. Zu diesem Zweck wurde er mit dem Besitzer eines hölzernen Kahns handelseinig, der ihn herumrudern sollte. Und so kam er anderntags in den Genuß einer kleinen Fahrt, die durch Flußschlingen führte, vorbei an Wäldchen mit Algarrobosträuchern, vorbei an Totwässern, die faulig rochen und über die eine grünfleischige Pflanzenschicht gebreitet lag, als müßten darunter schwerwiegende Geheimnisse verdeckt bleiben. In manch einem der toten Arme steckte ein Kahn fest, der von den Besitzern verlassen worden war. Vielleicht waren die Kahnfahrer von den Pflanzen erstickt worden und erzählten da unten mit körperlosen Stimmen, mehr ein Gemurmel denn ein Sprechen, ihre todtraurigen Geschichten.
Traumentflogene Schmetterlinge gaukelten heran, riesige, träge Segler, azurblau, karmesinrot, in flammendem Orange, oder Winzlinge, zitronengelb und apfelgrün gescheckt. Eine dichte Wolke von Mücken begleitete das Boot, dem Fährmann schienen sie nichts anzuhaben, aber in Richards Fleisch stachen sie erbarmungslos, obwohl er sich reichlich mit Mittelchen eingeschmiert hatte, keineswegs einladend, sondern abscheulich roch. Der Fährmann war ein gelassen beobachtender Mensch, der sich jeden Kommentars enthielt, wenn Richard wie ein Wilder um sich schlug, um das Geziefer zu verscheuchen, bis er sich endlich in sein Schicksal ergab. Glucksen und Wassergehüpf von Tierchen, die von Seerosen- und treibenden Palmblättern sprangen, begleiteten die Fahrt. Diese Gewässer schienen von Viechern förmlich zu brodeln. Das lebte und schmatzte und gurgelte, flog und schwamm und hüpfte in einem fort. Krokodile, auf die er gehofft hatte, blieben allerdings im Verborgenen. Statt dessen wurde die murmelnde Stille von Papageiengezeter durchbrochen: Geschwader von geärgerten Vögeln mit grünblauen Brustlätzen stiegen von den Bäumen auf.
In der Nacht lag Richard mit rot geschwollenen Beinen, einem zerkratzten Hals, zerkratzten Unterarmen im Bett, er fluchte und wälzte sich herum, kratzte und kratzte, obwohl er sich das zum hundertsten Mal verbot, und fand keinen Schlaf. Am Morgen saß ein ramponierter Westernheld vor seinem Maniokbrei und zweifelte, ob er die große Flußfahrt wirklich unternehmen sollte.
Wenige Stunden später lag er in der Hängematte eines kleinen Frachtschiffs, das Kurs auf Iquitos nahm. Nein, bequem war es nicht. Es war die Hölle. Die Matten waren dicht an dicht aufgespannt, er hatte sich keinen Außenplatz sichern können, lag Gesäß an Gesäß mit einem wildfremden Mann; die Latrinen waren derart versaut, daß er beschloß, Essen und Trinken einzustellen. Nachdem sein Entsetzen über die Zumutung so ungewohnter körperlicher Nähe einer fatalistischen Gemütsruhe gewichen war, wurden gute nachbarschaftliche Beziehungen hergestellt, Bananen und Fladen herumgereicht, Karten gespielt, gelacht und geschwätzt.
Richard hatte sein Spanisch in Argentinien gelernt, manche Ausdrücke, die er benutzte, riefen Heiterkeit hervor. Ernst wurden die Mienen seiner beiden Mattennachbarn, stämmiger Kleinhändler mittleren Alters, die mit Säcken voller Bohnen und Süßkartoffeln zu den am Fluß gelegenen Marktflecken unterwegs waren, sobald sie Richard über Deutschland ausfragten. Deutschland flößte ihnen Respekt ein. Von der Teilung in Ost und West hatten sie noch nie gehört. Hitler hielten sie für einen großen Mann, einen echten cojudo mit Eiern groß wie Stiereier, der sich nichts gefallen ließ; einer glaubte gar, der Diktator sei noch am Leben. Trotz der herzhaften Beziehungen, die von Matte zu Matte angeknüpft worden waren, war Richard froh, als sie nach einigen Tagen in Iquitos anlangten und er die Bequemlichkeit einer Badewanne genoß, in einem Hotel, das Jahrzehnte zuvor das verschwenderische Domizil eines Kautschukbarons gewesen war.
Zwei Tage später, nachdem er das ehemals wegen des Kautschukhandels wie ein Pilz aus dem Boden geschossene und dann rasch wieder verblühte Städtchen erkundet hatte, befand er sich endlich auf dem Strom, der hier, am Zusammenfluß des Rio Ucayali und des Rio Marañón, als Amazonas begann. Er hätte es besser nicht treffen können. Auf dem brasilianischen Frachter, dessen himmelblauer Anstrich mit den grünen Aufbauten ihm schon im Hafen verlockend erschienen war, hatte er sich die vorderste Hängematte verschaffen können. Da hing er nun für sich im Freien und ließ den lauen Fahrtwind über seinen Körper streichen. Der Wind war gerade stark genug, daß er es den Mücken unmöglich machte, sich darin zu halten, und er war zu schwach, um auf Dauer unangenehm zu werden. Eine wahre Erlösung! Wenn er sich auf das konzentrierte, was vor seinen Augen lag, konnte er sich einbilden, er sei ganz allein auf dem Schiff, und dieses Schiff würde wie von selbst nach seinen Wünschen gelenkt.
Auf dem Amazonas gab es ein dunstiges Einerlei, unterbrochen nur von dramatischen Sonnenuntergängen und milden Sonnenaufgängen, und Richard genoß die im Gleichmaß abrollenden Tage, die nichts, rein gar nichts von ihm forderten.
Von den Dschungelgeschichten, die er gierig gelesen hatte, wußte er, daß der Amazonas an manchen Stellen sich verbreiterte wie ein Meer, und genau so war es, allerdings hatte Richard ein braungraues Meer vor sich, kein blaues; weithin entzogen sich die Ufer den Blicken. Dann rückten die Ufer heran, und der Amazonas sah wieder aus wie ein Fluß. Daß er ein mächtiger Strom war, daran ließ der Amazonas nirgendwo einen Zweifel. Ganze Baumstämme trieben in ihm, er schleppte sie fort, als wären es Streichhölzer.
Aus den Tagen waren Wochen geworden, aus den Wochen ein Monat und mehr, Richard hatte den Überblick über die vorbeistreichenden Kalendertage längst verloren. Einen gleichförmigen Tag nach dem anderen in einer Hängematte zu verbringen, die so bequem war wie nichts sonst auf der Welt, löste einen merkwürdigen Schwebezustand aus. Ufernah, uferfern, seine Gedanken segelten in vollendeter Freiheit dahin, er döste und wachte im Wechsel, sah den Mond, sah die Sterne, weidete sich an den Wolken, die den Mond bedeckten und ihn wieder freilegten, sah diese Phänomene mit einer solchen Eindringlichkeit, als würde sein eigener, wohlig geborgener Körper mit den Himmelsmächten in geheimer Korrespondenz stehen. Ganz so, wie der Professor es einmal ausgedrückt hatte — als Kind sei man ganz und gar in den Genuß der Weltgunst gekommen; die Welt war einmal so für das Kind dagewesen, daß sie sich vor ihm verneigte und mit ihm weinte und Eskorte auf allen seinen Wegen war.
Richard, der zarte Richard mit den feinen blonden Haaren, hatte die Weltgunst aber bald verloren und war übergewechselt in einen Zustand, in dem er seine Eltern haßte und nicht recht wußte, wohin mit sich selbst. Und dieses leidige Nichtwissen hatte ihn jahrelang begleitet, bis er es später glänzenden Auges seinem Professor angetragen hatte, damit der ihm sage, wozu er in der Welt sei, wobei der Professor von seinen Nöten nicht das Geringste bemerkt, ja, wohl nur in einem entlegenen Gedächtniswinkel registriert hatte, daß es ihn überhaupt gab. Aus dem erbärmlichen Richard, der seinen Jammer mehr und mehr im Alkohol ersäuft hatte, war nun ein bedeutendes Wesen geworden, das auf der Mittellinie der Erde dahintrieb und mit den Toten in ebenso flüssigen Gedankenplaudereien in Verbindung trat wie mit den zungenfertigen Panthern seiner Kindheit.
Er fühlte sich ins Glück gerückt. Lau und warm, niemals heiß oder brennend war das Wetter, manchmal ging ein warmer Regen auf ihn nieder, den er ebenso genoß wie das anschließende Trockenwerden. Spektakulär waren die Sonnenauf- und Sonnenuntergänge. Rote Feuerzungen loderten abends über einer kompakten schwarzen Waldmasse, roséfarbener Frühnebel hüllte den scheu sich zeigenden Zartwald in ein morgendliches Negligé. Am meisten verblüffte ihn der schlagartig einsetzende Chor der Frösche und Kröten. Kaum waren die letzten Sonnenstrahlen vom Wasser zurückgewichen, ging auf die Sekunde genau dieser Chor los. Laut! Aus abertausend Froschkehlen wurde gequakt und geknarrt und gequarrt, was das Zeug hielt, einige Minuten lang, und genauso abrupt, wie der Lärm losgebrochen war, herrschte wieder absolute Stille, in die hinein sich nur der vertraute Motor des Schiffes zu hören gab.
Alles Unangenehme rückte in weite Ferne. Die Bundesrepublik, dies krampfige kleine Land mit seinen krampfigen Politikern, den krampfigen Terroristen, den krampfigen Feministinnen, war bloß komisch, ein Ländchen, das sich wichtig nahm, weiter nichts. Zu Richards Heiterkeit trug der Kapitän bei, der ihn üppig mit Marihuana versorgte und überhaupt ein höchst angenehmer Gesellschafter war. Es war einfach, sich mit ihm zu verständigen. Richard sprach in seinem argentinischen Spanisch, der Kapitän antwortete in einem spanisch-portugiesischen Mischmasch, welchem er durch Augenrollen, Brauenzusammenziehen sowie unter Zuhilfenahme flinker Hände, mit denen er Luftmalerei betrieb, deutenden Nachdruck verlieh.
Richard tat gar nichts, er lag einfach nur da, selbst dem Lesen, das sonst immer sein Tröster gewesen war, fühlte er sich nicht mehr gewachsen; Sein und Zeit schlummerte in der Tiefe seiner Tasche. Morgens erwachte er mit einem großen Plan, den der gleichgültige Strom in ein schwimmendes Ungefähr trug und in tausend glitzernde Tröpfchen zerlöste, was kein Schade war, denn Richard wachte am nächsten Morgen mit einem ebenso herrlichen anderen Plan wieder auf.