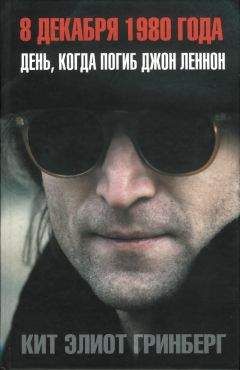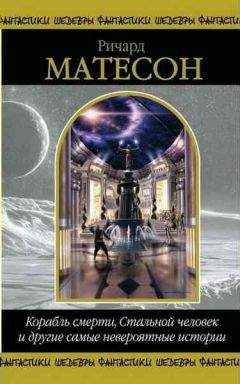Sibylle Lewitscharoff - Blumenberg
Auf dem Fußmarsch weg vom Hafen beruhigte er sich ein wenig. Mehr dem Inneren zu, als sie die baufälligen Hütten und einige grobe Neubauten hinter sich gelassen hatten, wurde die Stadt immer prächtiger. Es war nicht weiter schwer, ein passables Hotel zu finden, er fand sogar ein schönes, an seinem Unterbau glänzten die floral gemusterten Kacheln, mit denen die Portugiesen ihre reichen Häuser geschmückt hatten. Wahrscheinlich waren Kacheln in dem tropischen Klima eine beständigere Außenhülle als Holz oder ein gewöhnlicher Verputz.
María versprach, am nächsten Nachmittag vorbeizukommen und ihm die Stadt zu zeigen. Im Moment war für ihn alles zu neu, als daß er sich Sorgen hätte machen können, ob sie wiederkäme oder nicht. Mit seinem Hotelzimmer war er sehr zufrieden; es hatte einen Balkon auf eisernen Gerüsten, von dem man auf einen viereckigen Platz mit zwei mächtigen Palmen blickte. Trotzdem fühlte er sich in dem Zimmer wie eingesperrt, stickig war’s darin, nach wenigen Minuten ging er nach draußen, um sich vor ein Café zu setzen und an der freien Luft in Manaus heimisch zu werden.
Obwohl er kein Opernfreund war, hätte er liebend gern eine Darbietung im Teatro Amazonas besucht — allein die Vorstellung, sich in einer kleinen Stadt mitten im Urwald eine Oper anzuhören, war aufregend —, aber das berühmte, 1896 erbaute Theater war geschlossen, sein Inneres mitsamt dem opulenten Ballsaal wohl ziemlich baufällig, termitenzernagt; schon seit Jahrzehnten fanden hier keine glanzvollen Aufführungen mehr statt.
Am Abend aß er in einem kleinen Lokal eine Feijoada aus schwarzen Bohnen mit pfefferscharfen Wurststücken und einer geballten Ladung Knoblauch. Danach trank er zu viele Caipirinhas, die ihm nicht bekamen. Er streunte noch ein bißchen durch die Straßen, kam sich mehr und mehr verlassen vor und lag dann ziemlich früh, mit schwerem Magen, im Bett und konnte nicht einschlafen. Aus Verzweiflung eher denn aus Neigung kramte er Sein und Zeit aus seiner Tasche, schlug darin, weil er sich schon in etlichen Anläufen mit dem Anfang abgequält und kaum etwas verstanden hatte, ein späteres Kapitel auf, dessen Überschrift ihm erlaubte, sie auf seine Situation zu münzen: Die Grundbefindlichkeit der Angst als eine ausgezeichnete Erschlossenheit des Daseins, und blieb an einer Stelle hängen, die auf ihn zuzutreffen schien, Stelle, an der es hieß, daß die Flucht des Daseins Flucht vor ihm selbst sei, aber im Wovor der Flucht komme das Dasein gerade hinter ihm her. Richard ließ das Buch auf seinen Bauch sinken — unzweifelhaft, etwas kam hinter ihm her, etwas zutiefst Angsterregendes kam hinter ihm her. Aber die Angst war diffus. Wie Heidegger sich ausdrückte, fungierte nichts von dem, was innerhalb der Welt zuhanden und vorhanden war, als das, wovor die Angst sich ängstete; die innerweltliche Bewandtnisganzheit des Zuhandenen und Vorhandenen war für die Angst ohne Belang. Sie sank in sich zusammen.
Er war tief in sein durchhängendes Bett eingesunken. Sein und Zeit hatte er mitgeschleppt in der Hoffnung, in anders farbigen Ländern, unter einer anders glühenden Sonne, würde sich ihm der Sinn des rätselvollen Buches wie von selbst erschließen. Bisher war ihm das nicht gelungen, und so hatte er das schwerste Stück seines Gepäcks eher wie einen nutzlosen Stein herumgetragen. Jetzt, zum ersten Mal, hatte ihn eine Stelle in diesem Buch gepackt, ihn angesprochen, als wäre sie eigens für ihn verfaßt worden. Aus dem Buch entstieg etwas ins nicht mehr Geheure. Böse Gedankenfinger umtasteten sein Herz.
Nach einer schweren Nacht, in der die dunkle Bohnenmahlzeit eine düstere Verbindung mit seinen Ängsten einging, erwachte er am nächsten Morgen zerschlagen. Zehn Uhr fünf. Das Wetter war wie immer. Feucht. Warm. Freundlich.
Er bekam Lust, mit María die berühmten Seerosen auf der anderen Seite des schwärzlichen Flußes anzusteuern. In einem Reiseführer hatte er tablettrunde Riesenblätter gesehen, von einer Größe und Stärke, daß ein mageres Knäblein wohlbehalten darin schlummern konnte, ohne unterzugehen. Lufterfüllte Zellen erlaubten der Vitória Regia, sich schwimmend zu erhalten. Einkerbungen am hochgewölbten Rand ließen das Regenwasser ablaufen. Vielleicht würden María und ihm von den Seerosen Winke zugetragen, welches gemeinsame Schicksal ihnen bestimmt war. Die an Wundern reiche Natur konnte ihnen das Wahrscheinliche im Unwahrscheinlichen offenbaren, wer weiß, vielleicht bekämen sie Lust, auf einem Seerosenblatt zu wohnen.
Den Vormittag über streunte er herum. Allmählich gefiel ihm die Stadt. Die portugiesischen Kolonialbauten waren außergewöhnlich, filigran und üppig zugleich. Was für eine Verschwendungssucht mitten im Dschungel! Es mußte unglaublich anstrengend gewesen sein, all die Bauteile hierher zu verfrachten. Zu der Zeit gab es in Manaus keine Industrie, die das Material für solche Prachtbauten hätte liefern können.
Auf der Veranda des Hotels wartete er auf María, gehüllt in tiefe Besorgnisse, was nun zu sagen und zu tun sei, entwarf Pläne, die er sofort wieder verwarf. Für seine Pläne hätte er sich selbst überwachsen müssen. Sie hätten die Tatkraft eines Riesen von ihm verlangt.
María kam pünktlich, was für eine Südamerikanerin außerordentlich war. Die Leute kamen meistens mindestens dreißig Minuten nach der vereinbarten Zeit.
Sie schien gehemmt. Begrüßte ihn nicht mit der Anmut, mit der sie ihm sonst die Hand auf die Stirn gelegt oder seine Hand ergriffen hatte. Wahrscheinlich ist sie befangen wie ich selbst, dachte Richard. Eine Weile gingen sie etwas verkrampft nebeneinander her; Richard überwand sich zu seinem Seerosenvorschlag, der mit einem kurzen Nicken als Bestätigung aufgenommen wurde.
Richard wunderte sich. Normalerweise hätte María einen solchen Vorschlag mit entzückendem Geplapper quittiert und ihm gleich rund um die Seerose neue Wörter beigebracht. Heute blieb sie erstaunlich wortkarg.
Sie war ihm einen halben Schritt voraus und ging Richtung Hafen, aber einen anderen Weg als den, den sie gekommen waren. Richard hatte seine Straßenkarte gar nicht mitgenommen, da ihn María führte. Die Gegend wurde ärmlicher, überall niedere Häuser mit halb verfallenen Anbauten, von denen die papageienbunten Anstriche abblätterten.
Verwundert blieb Richard stehen. In einem Hof hingen Fleischstücke an der Wäscheleine. In Salz eingelegtes Fleisch, das an der Sonne trocknete, wie María ihm versicherte, offenbar eine Spezialität der Region, von der er noch nie gehört hatte. Das hängende Salzfleisch wirkte auf ihn makaber, es verlangte ihn nicht unbedingt danach, die Speise, die man daraus bereitete, demnächst zu probieren. Bei den Regengüssen, die regelmäßig drohten, mußte das Fleisch unter Beobachtung stehen, immer wieder abgenommen und neu aufgehängt werden.
Ihre Tante wohne nicht weit von hier, erklärte María, sie kenne bestimmt einen guten Bootsmann, mit dem sie die Fahrt unternehmen könnten. Sie bogen um eine Ecke, hier herrschte nicht der übliche Betrieb von Leuten, die etwas zu besorgen hatten, die Straße wirkte ärmlich. Zwei junge Männer lehnten an einer Holzwand, die Hände unter die Achseln gesteckt, zwischen ihnen der offene Eingang zu einem Schuppen. Richard wurde mulmig zumute, er hätte gern die Straßenseite gewechselt, aber er vertraute auf María, die sich hier ja auskennen mußte. Sie blieb einen Schritt zurück, warum bleibt sie zurück, dachte er, sie hätte doch eher vorausgehen müssen, da lösten die Männer ihre Rücken von der Wand und traten ihm entgegen. Ein kompakter Kerl, kleiner als Richard, in dunkler Hose, dunklem Hemd, Sonnenbrille auf der breiten Nase, sprach ihn an. Richard verstand nicht, es klang nach einer groben Beschimpfung, die Wörter wurden bellend hervorgestoßen, er drehte sich nach María um, damit sie ihm helfe, aber sie war weiter zurückgewichen und wirkte wie nicht recht anwesend. Jetzt mischte sich auch der andere ein und tippte ihm aggressiv vor die Brust, ein größerer Bursche im Hawaiihemd, ein goldenes Kreuz an der Kette baumelte von seinem Hals — María, der Name fiel immer wieder, offenbar kannten die Burschen das Mädchen und wollten eine Bezahlung. Aber wofür?
Um sie zu besänftigen, probierte Richard einige spanische Sätze an ihnen aus, aber das hatte den falschen Effekt. Sie wurden noch wütender, aber gerade so, als hätten sie ihre Wut auf dem Theater einstudiert. Ihre erregten Stimmen wirkten auf Richard fast komisch; er faßte den Mann im Hawaiihemd am Arm, um ihn zu beruhigen, da wurde er in den Schuppen hineingestoßen, lag, eh er sich’s versah, auf dem dreckigen Boden zwischen allerlei Gerümpel.
Beim Sturz hatte er sich die Hände aufgeschürft. Die Innenflächen brannten. Ich werde eine Blutvergiftung bekommen, dachte er. Dann war der Kerl im Hawaiihemd über ihm und fingerte an seinen Hüften herum. Richard packte der Zorn. So kläglich wollte er sich vor seinem Mädchen nicht geschlagen geben, so nicht. Er verpaßte dem Mann einen kräftigen Tritt, der taumelte rückwärts, und Richard kam wieder auf die Beine. Er keuchte und schwitzte. Vor dem offenen Schuppentor, lichtumflossen, stand María, die Füße einwärts gedreht, Hände unter den Bauch gekrampft. Lange konnte er diesen Anblick nicht begrübeln. Der schwarze Kompaktmann rannte auf ihn zu und stieß ihm ein Messer ins Herz. Wo ist die Sonnenbrille geblieben, dachte Richard, als er das Gesicht mit der fleischigen Nase so unbegreiflich nah vor sich sah. Der Ausdruck darin war nicht zornig, er wirkte methodisch, fachmännisch. Richard ging in die Knie, vom warmen Blut ganz naß sein Bauch, das fühlten seine Hände. So lange er konnte, schaute er zum offenen Tor hinaus. Im Lichtfraß stand sein Mädchen. Ob es? Er wehrte sich gegen den Gedanken und kippte zur Seite.
Nachzutragendes
Fast zwei Monate dauerte es, bis die Eltern Richards in Paderborn davon erfuhren, daß ihr Sohn in Manaus zu Tode gekommen war. Rasch war der Tote gefunden worden, ausgeraubt, ohne Papiere. Der Paß tauchte erst sechs Wochen später auf einer Müllkippe wieder auf. Vom Hotel aus wurde schon am nächsten Tag gemeldet, daß ein Gast fehlte, aber der fehlende Gast hatte sich mit so krakeliger Schrift eingetragen und der Portier es versäumt, seinen Paß einzubehalten, daß der Name nicht eindeutig festgestellt werden konnte. Den ersten Hinweis fand die Polizei in einem schweren Buch, das aufgeschlagen auf dem Nachttisch seines Hotelzimmers lag: Richard P. stand in einer schülerhaften Schrift auf dem Vorsatzblatt. Erst Wochen später kam Gewißheit auf, daß es sich bei dem Getöteten um einen jungen Mann aus Deutschland handeln mußte mit Namen Richard Pettersen. Sein Mörder wurde nie ermittelt.
Als der Vater in Manaus anlangte, um die Leiche seines Sohnes nach Deutschland zu überführen, erwartete ihn eine böse Überraschung: sie konnte nicht gefunden werden. Wahrscheinlich war sie zusammen mit anderen Todesopfern, die lange unidentifiziert geblieben waren, irgendwo verscharrt worden.
Hermann Pettersen hatte viele Nöte und Bitternisse zu erleiden; ohne ein Wort Portugiesisch und mit schlechtem Englisch, mit lauer Unterstützung seitens der deutschen Botschaft, eilte er tagelang von einem Amt zum anderen, nur um verwirrende und ausweichende Auskünfte darüber zu erhalten, was genau mit seinem Sohn geschehen war und wo die Leiche geblieben sein mochte. Er mußte ohne Sarg zurückfliegen.
In Münster wiederum erfuhr man erst ein halbes Jahr später von Richards Tod. Seine Wohnung hatte er gekündigt, keiner der Freunde und Kommilitonen stand mit Richards Eltern in direkter Verbindung. Die Zeitungen berichteten nicht über den Mord. Zufällig verbreitete sich die Nachricht über eine alte Schulkameradin Richards, die ihren Studienplatz nach Münster verlegt hatte. Gerhard hatte sich schon gewundert, weshalb die Briefe des Freundes so lange ausblieben; in immer längeren Abständen zwar, aber doch mit einiger Regelmäßigkeit waren sie bisher eingetroffen.
Nun hatte Gerhard also auch noch Richard für immer verloren. Das brachte ihn dazu, strenger als bisher zu arbeiten. Münster war ihm verleidet. Er wollte möglichst rasch fort. Zwei Jahre später lebte er schon in München, trat dort seine erste Assistentenstelle an und lernte eine Münchnerin kennen, die kurz darauf seine Frau wurde.
Hansis Wege waren komplizierter. Auch sie führten bald aus Münster hinaus. Zunächst nach Zürich, dann nach Berlin, mehrmals zwischen den beiden Städten hin und her, dann endgültig nach Berlin. Einen Abschluß machte er an keiner der Universitäten, an denen er Vorlesungen besuchte. Allerdings erregte er in Berlin einiges Aufsehen, als er in der Bleibtreustraße, nahe dem Kurfürstendamm, eine philosophische Beratungspraxis eröffnete und in großflächigen Anzeigen mit verhackstückten Blumenbergzitaten dafür warb — Was ist ein angemessenes Sterbebettfazit? Sorgen Sie rechtzeitig vor! hieß es da, oder: Jeder Mensch bestätigt sich darin, gewisse Proben zu bestehen, und er scheitert daran, in ihnen erlegen zu sein. Bei mir lernen Sie besser scheitern!
Seine Kommilitonen in Münster hatten übrigens richtig vermutet — Hansi war vermögend und konnte tun und lassen, was er wollte. Über die Jahre war sein Vortragsdrang erlahmt. Solange er seine Praxis betrieb, wo er meist in einem weißgekalkten Behandlungszimmer saß und wartete, sah man ihn nicht mehr mit seinen Gedichten und dem verbeulten Blechaschenbecher die Cafés abklappern. Durch die geschickten Anzeigen angelockt, waren in seiner Praxis anfangs einige Neugierige erschienen; sie wurden zeremoniell empfangen und in einen Wassily Chair gesetzt, aber selbst die Verrücktesten unter ihnen kehrten nicht wieder. Hansi war und blieb ein Solitär. Unfähig, Menschen zuzuhören, war er nur fähig, sie von seinem Schreibtisch aus niederzusprechen, wobei er seine Patienten selten ansah, sondern auf ein Acrylbild an der gegenüberliegenden Wand starrte, das einen ins Wasser eintauchenden Schwimmer zeigte. Eine solche Behandlung ließ sich kaum jemand zweimal gefallen, der sich ratsuchend zu ihm verirrt und am Ende der einstündig auf ihn niedergegangenen Tiraden hundert Mark zu erlegen hatte.
Hansis alter Drang lebte aber sofort wieder auf, als die Praxis einging. Allerdings trat er jetzt nicht mehr mit Gedichten an die Wirtshaustische heran, sondern mit selbstentworfenen Traktaten, womit er sich bei den Gästen noch schneller verhaßt machte, als er es mit den Gedichten getan hatte. Auf den Aschenbecher verzichtete er. Offenbar erschien es ihm unbillig, in der Öffentlichkeit Geld zu verlangen, wofern es sich nicht um eine ästhetische Darbietung handelte, sondern um Weckrufe von ihm selbst.
So schritt die Zeit voran, und Gerhard sollte mit seiner Prophezeiung recht behalten, vielleicht nicht mit dem Wangenzucken, aber mit allem anderen. Beängstigend schnell hatte sich Hansis Verfall vollzogen. Nach wenigen Jahren gab es nicht mehr den schmucken Hansi von ehedem, der Nacht für Nacht durch die Kneipen von Kreuzberg und Charlottenburg geisterte: Hansi war heruntergekommen. Ein geschultes Auge hätte vielleicht erkennen können, daß seine Kleidung einstmals eine sehr gute gewesen war; jetzt war sie abgeschabt und verschmutzt. Das Haar, vor der Zeit grau und schütter geworden, trug er noch immer lang. Mit seinen markanten Zügen sah er fast aus wie Antonin Artaud in den späten Verwitterungsphasen, da fehlende Zähne den Mund hatten zusammenfallen lassen.